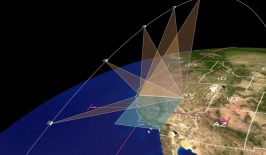Man kann Taktik dahinter vermuten, dass der Fraunhofer-interne Preis „Technik für den Menschen und seine Umwelt“ dieses Jahr an dieses Forschungsprojekt geht, bekommt doch das Thema Impfstoffe derzeit eine nie zuvor dagewesene Aufmerksamkeit. Aber ob Taktik oder nicht, die Technologie, die am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig, am Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP in Dresden und in Stuttgart am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA entwickelt wurde, scheint vielversprechend.
Ein Impfstoff funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip: Dem Körper wird ein gefährlicher Eindringling vorgegaukelt, ein Virus, ein Bakterium, ein Parasit. Der menschliche Körper erkennt den Eindringling, versucht, ihn unschädlich zu machen und generiert Antikörper und das Immunsystem lernt, wie es künftig auf eine Infektion reagieren muss.
Als „Fahndungsfoto für das Immunsystem“ beschreibt Jasmin Fertey vom Fraunhofer IZI in Leipzig diese Proteine, die bei der Impfung injiziert werden und auf die der Körper mit einer Immunantwort reagiert. Doch ein Virus, das dem Körper mit der Impfung gespritzt wird, besteht zunächst nicht nur aus dieser Hülle aus Proteinen und Lipiden. In seinem Inneren befindet sich die Erbinformation, durch die sich das Virus im Körper unkontrolliert vermehren würde. Deshalb muss bei der Impfstoffherstellung diese Erbinformation zerstört werden.
Elektronenbeschuss statt giftige Chemikalien
Am IZI geschieht das seit 2018 in einer mehr als mannshohen, viereckigen Prototypenanlage. In ihrem Inneren wird der Impfstoff mit Elektronen beschossen. Diese negativ geladenen Teilchen zerstören die Erbinformation der Viren, lassen aber von der Außenhülle genug übrig, um das Immunsystem zu täuschen. Bisher werden gefährliche Chemikalien wie Formaldehyd für diesen Prozess verwendet, oder die Erreger werden in gut abgeschirmten Speziallabors mittels Gammastrahlung aus radioaktivem Zerfall behandelt. Bei der Impfstoffherstellung im industriellen Maßstab kommen dabei große Mengen der toxischen Chemikalien zusammen – nicht nur eine Herausforderung für die Arbeitssicherheit, sondern auch eine Belastung für die Umwelt. „Unser Ziel war, ein Gerät zu konstruieren, das man in einem normalen Labor betreiben kann“, so Jasmin Fertey, ohne Strahlenschutz und ohne giftige Substanzen, die hergestellt und entsorgt werden müssen.
Elektronen werden bisher schon verwendet, um Oberflächen zu sterilisieren. Das geschieht beispielsweise bei Implantaten. Eine Herausforderung für die Wissenschaftler*innen war, dass die niederenergetischen Teilchen im Gegensatz zu hochenergetischen Gammastrahlen schnell Energie verlieren, wenn sie in eine wässrige Impflösung eindringen. Damit zuverlässig alle Viren getroffen werden, darf der Flüssigkeitsfilm deshalb nur ganz dünn sein.
Um das zu erreichen, haben die Wissenschaftler*innen gleich mehrere Methoden entwickelt. Eine davon beschreibt Jasmin Fertey als einen „Deo-Roller“: Eine Rolle dreht sich durch eine Flüssigkeit und nimmt wie die Kugel des Deo-Rollers einen dünnen Flüssigkeitsfilm auf. Dieser wird unter dem Bestrahlungsfenster von den Elektronen getroffen, danach wird der Impfstoff mit den inaktivierten Viren abgestreift. Das geschieht im Idealfall in Millisekunden und damit wesentlich schneller als die Impfstoffherstellung mit Formaldehyd, die mehrere Tage zur Inaktivierung der Viren braucht. Mehrere Liter Impfstoff können so pro Tag hergestellt werden.
Eine andere Methode ist das sogenannte „Beutelmodul“: Zehn bis 20 Milliliter Impfstoff sind in elektronendurchlässigen Beuteln verpackt. Eingespannt zwischen zwei Fließbändern werden die Beutel unter dem Bestrahlungsfenster straffgezogen, sodass auch hier ein dünner Flüssigkeitsfilm entsteht. Zwar ist diese Methode mit mehr Materialaufwand verbunden und eher für kleinere Impfstoffmengen geeignet, aber sie hat einen entscheidenden Vorteil: Die Impfstoffe berühren die Produktionsanlage nicht. Somit können in kurzer Folge verschiedene Impfstoffe ohne vorherige Reinigung hergestellt werden – für Impfstoffforschung wie am Fraunhofer-Institut in Leipzig ist das das Mittel der Wahl.
Getestet haben die Wissenschaftler*innen die Technologie schon an Influenza-Viren, aber Jasmin Fertey sieht auch Chancen für ganz andere Krankheiten. Bakterien können mit der Elektronen-Methode ebenfalls unschädlich gemacht werden, und sogar gegen Parasiten wie Plasmodien können nach Angaben der Forscher gezielt soweit abgeschwächt werden, dass sie nicht mehr schädlich sind und dennoch nicht völlig zerstört werden – eine Impfung gegen Malaria rückt in greifbare Nähe.
Dass in Leipzig nicht an Impfungen gegen Covid-19 geforscht wird, hat zwei Gründe: Zum einen erfüllt das Labor mit dem Prototypen nicht die erforderliche Sicherheitsstufe. Zum anderen habe es keine Notwendigkeit gegeben, erklärt Jasmin Fertey: „Im März letzten Jahres gab es schon 50 Impfstoffkandidaten, die noch übrig waren vom ersten SARS-Ausbruch. Viele haben das Rad nicht neu erfunden. Wir haben uns gedacht, wir müssen uns nicht einreihen hinter riesengroße Pharmakonzerne.“
Dennoch freut sie sich über den Fortschritt bei der Impfstoffentwicklung mit konkurrierenden Methoden. „Es ist nicht sinnvoll, nur auf eine Technologie zu setzen“, sagt sie. „Was für das eine Virus funktioniert, muss nicht für ein anderes ebenfalls funktionieren.“
Derzeit arbeiten die Wissenschaftler noch an Details, um das Produkt marktreif zu machen. So soll ihre Elektronenschleuder noch kleiner werden, damit sie besser in vorhandene Produktionsumgebungen und Labore passt. Einen Industriepartner haben sie schon, der will das Gerät künftig in Lizenz herstellen und verkaufen.