Viele Länder setzen bei der Umstellung auf saubere Energie auf Sonnenkollektoren. Doch die Solarmodule benötigen natürlich entsprechende Flächen. Eine neue Lösung, um Platz zu sparen, besteht darin, die Paneele auf Gewässern schwimmen zu lassen: Floatovoltaik. Der Gewinn an potenziellen Flächen könnte dazu beitragen, die Solarenergie weltweit noch weiter zu verbreiten und so die Energiewende vorantreiben, aber die Auswirkungen auf die Umwelt sind noch weitgehend unerforscht.
Eine der weltweit ersten kommerziellen schwimmenden Solaranlagen wurde 2008 auf dem Bewässerungsteich eines kalifornischen Weinguts installiert. Seitdem wurden größere Anlagen mit einer Kapazität von Hunderten von Megawatt auf Seen und Wasserkraftreservoirs in China errichtet, weitere sind in Südostasien und Brasilien geplant.
„Floatovoltaik ist heute eine der am schnellsten wachsenden Technologien zur Stromerzeugung und eine vielversprechende kohlenstoffarme Energiequelle“, sagt Rafael Almeida, Assistenzprofessor für aquatische Ökosysteme an der University of Texas Rio Grande Valley.
Almeida erläutert, dass schwimmende Paneele idealerweise in von Menschenhand geschaffenen Gewässern wie Bewässerungskanälen und den Stauseen von Wasserkraftwerken aufgestellt werden, um kein Land zu verbrauchen, das ansonsten für Naturschutzgebiete oder die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden könnte. Vor allem Stauseen von Wasserkraftwerken haben den Vorteil, dass sie bereits über die Infrastruktur für die Stromverteilung verfügen.
Almeida und seine Kollegen berechneten das weltweite Potenzial für die Nutzung der Floatovoltaik auf der Grundlage der Fläche der Wasserkraftreservoirs der Länder. Sie fanden heraus, dass Länder in Afrika und Nord- und Südamerika das größte Potenzial für die Energieerzeugung durch diese Technologie haben. Brasilien und Kanada zum Beispiel könnten in diesem Sektor führend werden; sie würden nur etwa 5 Prozent der Flächen ihrer Stauseen benötigen, um den gesamten Bedarf an Solarenergie bis zur Mitte des Jahrhunderts zu decken. Die Forschenden haben ihre Ergebnisse am 12. Dezember auf der Herbsttagung 2022 der AGU vorgestellt.
Abschätzung der Umweltauswirkungen
„Wir müssen alle Möglichkeiten zur Steigerung der kohlenstoffarmen Energieerzeugung bei gleichzeitiger Minimierung der Flächennutzungsintensität ernsthaft in Betracht ziehen“, betont Almeida. „Aber wir müssen auch verstehen, wie wir unerwünschte soziale und ökologische Auswirkungen reduzieren können“, fügt er hinzu und erklärt, dass wir noch wenig über die Auswirkungen der Bedeckung großer Wasserflächen mit Sonnenkollektoren wissen.
Regina Nobre, eine Süßwasserökologin an der Paul Sabatier Universität in Toulouse, Frankreich, stimmt dem zu. Nobre war nicht an den jüngsten Forschungsarbeiten beteiligt, gehört aber zu einer Gruppe, die gerade eine Pionierarbeit zur Überwachung der Umweltauswirkungen von schwimmenden Solaranlagen in alten Kiesgrubenseen in Europa begonnen hat. Diese Gruben wurden ursprünglich für den Bergbau angelegt, füllen sich aber nach der Stilllegung auf natürliche Weise mit Flusswasser und beherbergen ein vielfältiges aquatisches Leben. Nobre kann noch keine Ergebnisse vorweisen, glaubt aber, dass die Erkenntnisse aus ihrer Umweltverträglichkeitsstudie für politischen Entscheidungsträger*innen von entscheidender Bedeutung sein könnten.
„Die Technologie entwickelt sich rasant, und wir brauchen dringend mehr Daten, um die Auswirkungen zu verstehen und den Umweltbehörden und der öffentlichen Politik eine bessere Orientierung zu geben“, sagte sie.
Zum einen könnten großflächige Paneele das Licht im Wasser blockieren, so Nobre, und so die Ernährungs- und Vermehrungsmuster von Algen verändern. Das wiederum könnte zu Sauerstoffmangel im See führen und kaskadenartige Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben, was dann natürlich anderen Wildtieren und der lokalen Fischerei schaden würde.
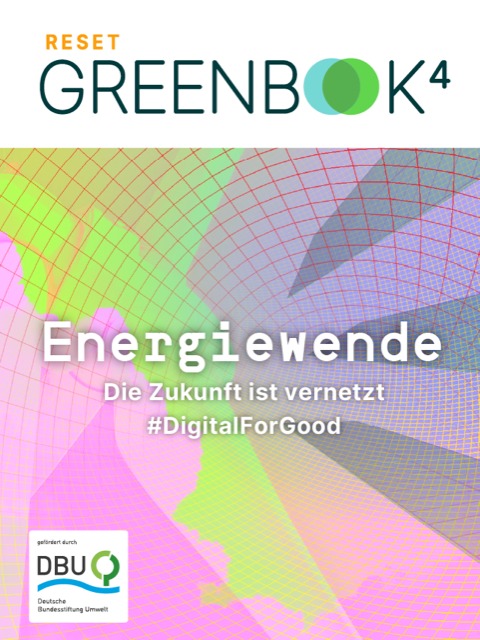
Das 1,5-Grad-Ziel ist ohne eine echte Transformation unseres Energiesystems unerreichbar. Aber wie kann sie gelingen? Was sind die Energiequellen der Zukunft? Welche digitalen Lösungen stehen bereit und wo sind Innovationen gefragt? Und wie kann die Transformation vorangetrieben werden?
Das RESET-Greenbook „Energiewende- Die Zukunft ist vernetzt“ stellt digitale, innovative Lösungen vor und beleuchtet die Hintergründe.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Paneele den Austausch von Treibhausgasen wie Methan zwischen dem Wasser und der Atmosphäre beeinträchtigen könnten, wodurch die Vorteile der Dekarbonisierung vielleicht wieder zunichte gemacht werden. Die partikelle Bedeckung der Wasseroberfläche könnte aber auch positive Effekte haben, wie zum Beispiel die Menge des Verdunstungswassers und die Wassererwärmung durch Sonneneinstrahlung reduzieren und Fischen und anderen Wassertieren Rückzugsraum und Kinderstube bieten. Die tatsächlichen Folgen sind jedoch ohne Studien nicht vorhersehbar und werden wahrscheinlich je nach Design der Paneele, Fläche und Landschaft variieren, so die beiden Forschenden.
„Wir müssen einen vorsorglichen Ansatz wählen“, sagte Almeida. „Einerseits dürfen wir diesem potenziell wichtigen Sektor nicht zu viele Hindernisse in den Weg legen, aber andererseits müssen wir die Kompromisse verstehen und die bestehenden Wissenslücken durch weitere Studien schließen“.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im AGU’s Eos Magazine und wurde hier im Rahmen von Covering Climate Now, einer globalen Initiative zur Stärkung der Klimaberichterstattung, nochmals veröffentlicht. Übersetzt hat den Artikel Sarah-Indra Jungblut.









