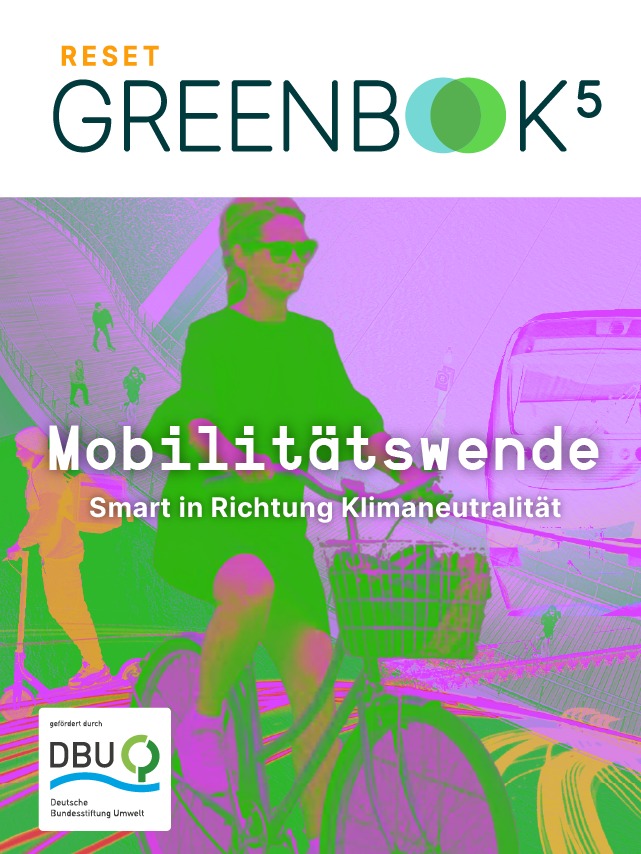Autonomes Fahren ist in aller Munde, Unternehmen wie Tesla, Nvidia und Uber arbeiten mit Hochdruck daran, ihre selbstfahrenden Autos auf die Straße zu bringen. Die autonomen Fahrzeuge sollen weniger Stress für die Fahrer*innen bedeuten und statt die Hände am Lenkrad behalten zu müssen, könnte die Fahrt in der eigenen Kapsel auch zum Arbeiten oder Schlafen genutzt werden. Technisch sind Autos schon jetzt in der Lage, mehr oder weniger zuverlässig selbstständig durch die Straßen zu navigieren. Doch bis hierzulande die Anwesenheit eines Menschen hinter dem Steuer nicht mehr nötig ist, ist es mindestens regulatorisch noch ein Stück Weg.
Die Frage ist aber: Brauchen wir wirklich autonome Privatfahrzeuge? Unsere Klimaziele im Verkehrssektor erreichen wir nicht dadurch, dass wir die gleiche Anzahl an Pkws durch E-Autos ersetzen oder autonom fahren lassen, sondern nur dadurch, dass wir auf Alternativen umsteigen. Und wer während der Fahrt andere Dinge tun möchte, hat – zumindest in den Städten – schon längst die Möglichkeit dazu. Öffentliche Verkehrsmittel bringen Passagiere zum Ziel, ohne dass diese einen Finger rühren müssen. Weniger fragwürdig dagegen ist die Hoffnung, das autonome Fahrzeuge eine unabhängige Mobilität für Menschen ermöglichen könnten, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht selbst fahren können. Dies kann sich auf ihre Beschäftigung, ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung und ihre Abhängigkeit von Familienmitgliedern und Freunden auswirken.
Was ist autonomes Fahren?
Das Ziel des autonomen Fahrens ist, zumindest einen Teil der Verantwortung für den physischen Betrieb von Fahrzeugen vom Menschen auf speziell ausgebildete Maschinen zu übertragen. Es gibt sechs Stufen der Automatisierung – die sogenannten SAE-Levels:
Stufe 0: Keine Automatisierung des Fahrens
Stufe 1: Fahrerassistenz
Stufe 2: Teilweise Automatisierung des Fahrens
Stufe 3: Bedingte Fahrautomatisierung
Stufe 4: Hohe Fahrautomatisierung
Stufe 5: Vollständig automatisiertes Fahren
Aufgrund rechtlicher und versicherungstechnischer Risiken ist die Chance, ein autonomes Fahrzeug der fünften Stufe auf der Straße zu sehen, in Deutschland jedoch noch weit entfernt.
Aber: Wie nachhaltig ist autonomes Fahren?
Auch wenn geschätzt wird, dass autonome Autos den Kraftstoffverbrauch um etwa 15 bis 20 Prozent senken werden, bringt das nur wenig Entlastung bei den verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Autos waren allein im Jahr 2019 für rund 164 Millionen Tonnen Treibhausgase verantwortlich und machen 61 Prozent der gesamten CO2-Emissionen des EU-Straßenverkehrs aus. Aus ökologischer Sicht ist es also keine große Verbesserung, die Straßen weiter mit Autos zu füllen – egal , ob autonom oder nicht.
Sobald jedoch mehr Fahrgäste mitfahren, sinken die Emissionen pro Fahrgast drastisch. Eine bessere Auslastung ist ein wichtiger Faktor für eine höhere Effizienz der Mobilität. Wesentlich sinnvoller scheint es daher, autonome Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr anstelle von Privatfahrzeugen einzusetzen. Die Idee: Mehr Fahrzeuge mit geringerem Personalaufwand könnten dabei helfen, den ÖPNV massiv auszubauen und durch das verbesserte Angebot noch mehr Menschen zum Einstieg bewegen. Die Vision: Kleine, autonome Shuttlebusse als geteilter Individualverkehr ohne Blechlawine, ohne „Stehzeuge“, ohne Warten auf den Bus – und durch eine intelligente Routenplanung mit flexiblen Ein- und Ausstiegen. Verschiedene Pilotprojekten jedenfalls erproben schon heute die Möglichkeiten autonomer oder automatisierter Shuttles.
Roboter-Shuttles folgen den Fahrgästen, nicht dem Fahrplan
In Darmstadt und im Kreis Offenbach startet im Mai 2023 ein Pilotbetrieb: Dabei schicken die Deutsche Bahn, der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die lokalen Verkehrsgesellschaften automatisiert fahrende Shuttles auf die Straße, die sich, ausgerüstet mit Kamera- und Sensortechnik, um den On-Demand-Betrieb kümmern.
In einer ersten Testphase sind die Shuttles noch ohne Fahrgäste, aber mit speziell ausgebildeten Fahrer*innen unterwegs sein. Danach erst sollen Testkund*innen das Angebot nutzen können. Ist auch dieser Test bestanden, sollen die Shuttles in die bereits bestehenden On-Demand-Angebote integriert werden. Ganz ohne Sicherheitsperson an Bord fahren die autonomen Fahrzeuge dann aber immer noch nicht. In den USA hingegen sind verschiedene Robotaxidienste bereits im kommerziellen Betrieb.
Be_automateD – Evaluierung der wahren Kosten
Im Projekt „Be_automateD“ wird aktuell ein Modell für automatisierte Shuttlebusse entwickelt. Das auf offenen Daten basierende Bewertungsmodell vergleicht die Infrastrukturkosten mit dem potenziellen Nutzen neuer Buslinien. Die Infrastrukturkosten beruhen auf einer umfassenden Analyse offener Daten für das betrachtete Gebiet, in diesem Fall am Beispiel der Stadt Köthen. Das Besondere daran ist, dass nicht nur die wirtschaftlichen Auswirkungen neuer Erschließungsgebiete untersucht werden, sondern auch deren Auswirkungen auf den Klimawandel und die Luftverschmutzung. Damit soll im Rahmen des Projekts ein ganzheitlicheres Kosten-Nutzen-Verhältnis von öffentlichen Verkehrswegen ermittelt und gleichzeitig ein Beitrag zur grünen Revolution im Mobilitätssektor geleistet werden. Durch die Bereitstellung einer detaillierten Analyse der lokalen Infrastruktur trägt das Projekt auch zu den digitalen Upgrades bei, die für die Einführung automatisierter und autonomer Systeme im öffentlichen Verkehr notwendig sind.
SMO-II – Künstliche Intelligenz kümmert sich um dich
Das kürzlich in Deutschland gestartete Projekt „SMO-II“ bringt die Automatisierung auf ein neues Niveau. Ziel ist es, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und anderen Technologien so viele Prozesse rund um die Mobilität wie möglich zu automatisieren. Im Mittelpunkt des Projekts steht das Erreichen der SAE-Automatisierungsstufe 4 sowie die Verbesserung der Fahrgastbetreuung. Ein Kontrollzentrum soll das Shuttle aus der Ferne überwachen und die Fahrzeuge fernsteuern, wenn die Sensoren und Manöver noch nicht ausgereift genug sind. Der Shuttle soll alle Anforderungen der Fahrgastnachfrage meistern, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.
Mobil 2040 – Wie kann das funktionieren?
Ein weiteres Projekt ist die Prüfung der technischen Machbarkeit von automatisierten Shuttlebussen für den Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Das Shuttle-Projekt Oberhavel – Mobil 2040 ist Teil eines größeren ÖPNV- und Mobilitätskonzepts, das auch ein integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt zum Ziel hat. Das Projekt basiert auf einer intensiven Analyse des heutigen ÖPNV-Angebots. Um die Realisierbarkeit der Kernroute zu prüfen, wurden Informationen über Verkehrsregeln, -dichte und -infrastruktur akribisch dokumentiert und ausgewertet und so erfasst, welche infrastrukturellen und verkehrlichen Herausforderungen auf Shuttles zukommen könnten. Diese Daten wurden mit dem Wissen über die derzeitige Nutzung des öffentlichen Verkehrs kombiniert, um Strecken zu finden, auf denen ein Shuttle bereits realisiert werden könnte. Deutlich geworden sind dabei auch die Hürden: Der Automatisierung bestimmter Strecken stehen derzeit eine hohe Verkehrsdichte, enge Straßen, zu viele Ampeln oder parkende Autos in Halteverbotszonen entgegen.
Doch neben den technischen Vorrausetzungen und Fragen nach Haftung und Versicherung muss auch geklärt werden, wie eigentlich die neuen Haltestellen aussehen sollten, welche Optionen für den Einsatz auf Abruf bereitstehen und wie Wartung und Energiemanagement aussehen sollten.
Es bleibt noch viel zu tun
Weltweit gibt es viele weitere Projekte, die autonome und automatisierte Shuttle auf den Weg bringen wollen, wie SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption), das in über 20 Städten in ganz Europa durchgeführt wird, sowie das ULTIMO-Projekt, das in drei europäischen Städten aktiv ist. Diese Projekte legen zwar wichtige Grundsteine, sind aber noch weit von einem Regelbetrieb entfernt. Pilotversuche auf öffentlichen Straßen unterliegen einer Vielzahl von Anforderungen, und die Genehmigungsverfahren sind langwierig und teuer. Shuttles, die derzeit als Direktverbindungen zu weiter entfernten Bahnhöfen im Einsatz sind, können nur mit sehr komplexen Einzelgenehmigungen getestet werden.
Mobilitätswende – Smart in Richtung Klimaneutralität
Autonome Fahrzeuge, E-Mobility, intelligente Verkehrsplanung, multimodal durch die Stadt – wie sieht die Mobilität von morgen aus? Wir stellen nachhaltig-digitale Lösungen für eine klimaneutrale Fortbewegung und Logistik vor und diskutieren neue Herausforderungen der „digitalen“ Mobilität: Mobilitätswende – Smart in Richtung Klimaneutralität
Auch verlässliche Folgenabschätzungen für autonome Shuttle-Dienste gibt es aktuell noch nicht. Sowohl der Ressourcen- als auch der Energiebedarf sind noch unklar, und es ist noch kaum abzuschätzen, ob sich autonome Fahrzeuge wirklich positiv auf die aktuelle Verkehrsverteilung auswirken. Klar ist jedoch schon jetzt: Ob autonome Shuttles dazu beitragen, die verkehrsbedingten CO2-Emissionen zu senken, hängt stark davon ab, wie sie eingesetzt werden.
Es liegt auf der Hand, dass autonome oder automatisierte Shuttles noch einen langen Weg vor sich haben; viele rechtliche, finanzielle und strukturelle Hürden stehen einem selbstfahrenden öffentlichen Verkehrssystem im Wege stehen. Doch während die Teslas, Nvidias und Ubers daran arbeiten, den – aus Perspektive des Klimaschutzes kritisch zu betrachtenden – privaten Pkw-Sektor zu revolutionieren, schaffen Projekte wie Be_automateD oder SMO-II die technologische Grundlage für einen autonomen öffentlichen Verkehr.

Dieser Artikel gehört zum Dossier „Mobilitätswende – Smart in Richtung Klimaneutralität“. Das Dossier ist Teil der Projekt-Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), in deren Rahmen wir vier Dossiers zum Thema „Mission Klimaneutralität – Mit digitalen Lösungen die Transformation vorantreiben“ erstellen.